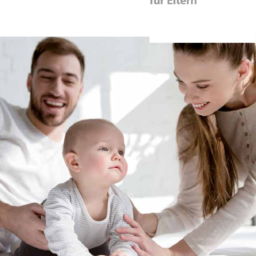„Der Test ist positiv.“ Eine Aussage, die in längst vergessenen Zeiten meist umgehend wohlwollende Glückwünsche auf den Plan rief, ist nun mit Vorsicht zu genießen. Wer nicht schnell genug hinterher schiebt, dass es sich dabei um den Schwangerschaftstest und nicht den Covid-19-Abstrich handelt, löst schnell einmal eine mittelgroße Massenpanik aus.
Doch was bedeutet es eigentlich, in der aktuellen Zeit guter Hoffnung zu sein?
Ich gebe es zu. Ich wäre gerne wie sie gewesen. Wie diese Schwangeren, die tiefenentspannt durch den gesellschaftlichen Ausnahmezustand schreiten, die ihre Maske so optimistisch tragen wie ihren stetig wachsenden Bauch und denen sich im Lockdown völlig neue Horizonte der gemütlichen Zurückgezogenheit offenbaren.
Doch so bin ich leider nicht. Das Einzige, das ich würdevoll trug, war die Flasche mit Desinfektionsmittel aus dem Drogeriemarkt, während die überraschendste Offenbarung dieser Tage der Coronastützpunkt auf dem Weg zum Kreißsaal war.
Zu Beginn meiner Schwangerschaft, als wir alle beim Begriff „Corona“ noch an ein Bier des örtlichen Getränkemarktes dachten, hatte ich wie viele Erstgebärenden klare Wunschvorstellungen in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt. In keiner davon sah ich mich mit Mund-Nasen-Schutz meine Wehen veratmen. Fairerweise muss ich an dieser Stelle aber auch einwenden, dass die Idee, im glamourösen Seidenmorgenmantel die Kontraktionen bei stimmungsvollem Licht freudig zu begrüßen auch ohne Pandemie recht anspruchsvoll war.
Als ich dann fröhlich ins dritte Trimester kugelte, zeichnete sich bereits langsam ab, was die Welt schon kurze Zeit später aus den Angeln heben sollte. Schneller als die Ziffern auf meiner Personenwaage schnellten nur noch die Infektionszahlen nach oben.
Anstatt weiter an einer ausgeklügelten Wochenbettbesuchsordnung zu feilen, musste ich mich auf einmal mit dem Gedanken befassen, dass selbst der werdende Vater möglicherweise nicht bei der Geburt dabei sein könnte. Eine Variante, die selbst in den abgespecktesten Versionen meiner Seidenmorgenmantelfantasie nicht vorkam.
Parallel zum Bauchumfang wuchsen Unsicherheiten und Ängste
Parallel zum Bauchumfang wuchsen also Unsicherheiten und Ängste. Einweghandschuhe und Maske gaben dem Begriff des Mutterschutzes eine ganz neue Bedeutung. Plötzlich gab es keine persönlichen Kontakte mehr, im Rahmen derer ich ungefragt Hände von Freunden und Verwandten an meinen Bauch drücken konnte, um die talentierten Tritte meines hochbegabten Wunderkindes vorzuführen. Die spannendste Demonstration im sozialen Rahmen beschränkte sich nunmehr auf das gemeinsame Hecheln ins Computermikrofon beim Onlinegeburtsvorbereitungskurs.
Ich vermisste meine Eltern, meine Familie, meine Freunde mit einer Intensität, dass es selbst das Loch in den Schatten stellte, welches das Fehlen von Rohmilchkäse auf meiner gematerten Schwangerenseele hinterlassen hatte.
Im Sturm der Hormone und angesichts der herannahenden Geburt fühlte ich mich beinahe persönlich beleidigt von Covid-19 und den damit einhergehenden Einschränkungen. So kam es, dass ich eines Tages pöbelnd und hochschwanger bei meiner Großmutter anrief. Ich muss gar nicht erst erläutern, dass ihre Reaktion auf das zwischenzeitlich gefährdete Seidenmorgenmantelszenario denkbar ernüchternd ausfiel. Nicht nur wies ihr Verständnis für meine beinahe spirituell geplante Geburtserfahrung eher enge Grenzen auf, auch meine Empörung über das mögliche Fehlen des Kindsvaters bei der Geburt war für sie nicht weiter beunruhigend. Die wenigsten Frauen ihrer Generation hatten während der Entbindungen ihren Partner an der Seite, von möglichen Geburtsvorbereitungskursen in der Schwangerschaft ganz zu schweigen.
Darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird
Ich wäre nicht ich, wenn ich aus diesem Gespräch postwendend geläutert und voller Dankbarkeit hervorgegangen wäre. Und doch gab es mir zu denken. Denn es ist vielleicht nicht immer ein ausgefuchstes Virus, das Schwangere vor Herausforderungen stellt. Möglicherweise ist es ein schwieriges soziales, politisches oder finanzielles Umfeld, vielleicht sind es äußere oder innere Belastungen, eventuell auch einfach nur das Fehlen von Rohmilchkäse und Sushi auf dem Speiseplan. Doch eines ist sicher – es wird sie immer geben und es hat sie bereits immer gegeben: die Frauen, die all diesen Unwägbarkeiten trotzen und ihr Baby ungeachtet dessen auf die Welt bringen. Und ich finde durchaus, dass das etwas ist, das Mut machen kann.
 Was heißt es nun also guter Hoffnung zu sein in Zeiten von Corona? Es bedeutet es nicht, dass wir die aktuellen Belastungen kleinreden müssen oder uns schlecht fühlen, wenn wir über Sorgen und Ängste klagen. Wir müssen uns nicht vergleichen, um uns am Ende mit einem „Schlimmer geht immer!“ zu trösten. Wir dürfen aber darauf hoffen und vertrauen, dass am Ende doch noch alles gut wird und wir die für diese Zeiten spezifischen Hürden meistern, so wie es bereits Generationen von Schwangeren vor uns gelungen ist.
Was heißt es nun also guter Hoffnung zu sein in Zeiten von Corona? Es bedeutet es nicht, dass wir die aktuellen Belastungen kleinreden müssen oder uns schlecht fühlen, wenn wir über Sorgen und Ängste klagen. Wir müssen uns nicht vergleichen, um uns am Ende mit einem „Schlimmer geht immer!“ zu trösten. Wir dürfen aber darauf hoffen und vertrauen, dass am Ende doch noch alles gut wird und wir die für diese Zeiten spezifischen Hürden meistern, so wie es bereits Generationen von Schwangeren vor uns gelungen ist.
Und sind wir doch einmal ehrlich. Wer möchte seinen Enkeln irgendwann schon vom Seidenmorgenmantel erzählen, wenn doch eine FFP2-Maske im Kreißsaal weitaus beeindruckender war.
Text: miru // Fotos: AdobeStock, sho